laut.de-Kritik
Missglückter Spagat zwischen Oldschool und Modern.
Review von Annika FeldmannDie irische Boygroup Westlife veröffentlicht nach "Spectrum" nun ihr zweites Album seit der Wiedervereinigung im Jahr 2018. "Wild Dreams" zeugt von den Bemühungen der Band, einen aktuellen, radiotauglichen Sound zu entwickeln, was im Grunde auch gelingt. Die meiste Zeit über ist das Ergebnis jedoch vorhersehbar und ermüdend. Überwiegend besteht die Platte aus austauschbaren Nummern ohne Erkennungswert, von denen man meint, sie schon mal irgendwann im Radio gehört zu haben, kurz bevor man den Sender gewechselt hat.
Westlife haben sich für's Hits Schreiben einige gestandene SongwriterInnen geangelt. Dabei wird das typische Dilemma gealterter Boygroups offenbar: Bedient man die Zielgruppe der treuen, mitgealterten Fans oder konzentriert man sich auf die jüngere Generation, die höchstens noch die großen Hits von einschlägigen 2000er-Playlists kennt? Der Spagat gelingt nicht so recht. Die Songs sind weder oldschool noch modern, das Album wabert im Electropop-Niemandsland und wäre dabei nicht einmal vor fünf Jahren besonders hip gewesen.
Die Produktion des Titeltracks "Wild Dreams" etwa klingt wie eine halbgare Mischung aus Chainsmokers und Dua Lipa, mit dem Einstieg "Yeah I've been livin' it up / Without a rhythm or rhyme" treffen sie den Nagel eigentlich schon ganz gut auf den Kopf. Die Vorab-Auskopplung "Starlight" erinnert an Coldplay zu ihren geschmackloseren Zeiten. Thematisch hebt sie sich auch nicht von dem Eindruck ab, dass die Jungs sich zwischendurch in ihre jugendlichen Herzschmerz-Phasen zurück versetzen wollten: "Maybe now this is our time for lovin' / You're the one, you're the one who made me smile / All over again and again now I'm singing / You saved me, this is a new beginning". Es ist stellenweise wirklich ernüchternd, wie gewollt modern und dabei hoffnungslos langweilig die Lieder daher kommen. Man nehme eine banale Pop-Ballade und lege einen sanften Reggaeton- oder Neo-80s-Beat darunter und heraus kommen Skip-Garanten wie "Alive" oder "Rewind". Überraschungen wären ja langweilig - auch lyrisch, denn die einfallslose Trennungs-Dilemma-Verzweiflung scheint nicht aufzuhören: "But deep in my soul I wanna know / Do you think of me at all? Is your heart still as broke as before or is it fixable?".
Die zweite Hälfte der Platte wird etwas erträglicher, weil Westlife weniger zwanghaft darauf bedacht scheinen, Airplay zu bekommen. Ed Sheeran tritt auf "My Hero" als Komponist in Erscheinung bringt einen kleinen Lichtblick zu Wege. Einen Song, der den 2010er-Pop zwar auch nicht neu erfindet, der aber in sich stimmig und unprätentiös ist. "End Of Time" ist solides Boygroup-Songwriting. Genau das, worauf sich Westlife verlassen können. "Magic" verlässt sogar endlich mal den strengen diatonischen Rahmen und entlockt im Chorus und Postchorus zum ersten Mal ein anerkennendes rhythmisches Kopfnicken. Doch selbst hier, im vergleichsweise originellsten Moment des Albums, drängen sich Vergleiche auf zu Popmusik, die es schon seit zehn Jahren gibt, etwa zu Maroon 5s' "Sugar".
Insgesamt haben Westlife hier die ganze Bandbreite an konventioneller und braver White-People-Bangers-Musik der vergangenen zehn Jahre abgegrast, sich von allem etwas genommen und ein Album produziert, vor dessen Hochglanz-Belanglosigkeit man nur staunen kann.

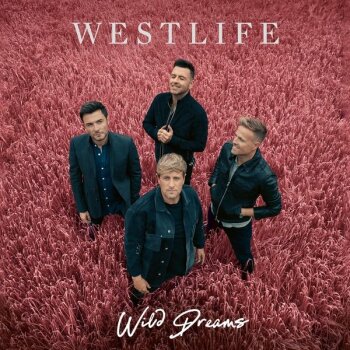

1 Kommentar
„(…)“Starlight“ erinnert an Coldplay zu ihren geschmackloseren Zeiten“ - haha, waren sie denn je geschmackloser als heute?