laut.de-Kritik
Im Hinterhof ist Amy Winehouse nicht weit.
Review von Kai ButterweckWochenlang irrte Neuseelands neuester Exportschlager Gin Wigmore für ihr zweites Album "Gravel & Wine" durch die USA - stets auf der Suche nach Inspiration und der wahren Essenz des Blues. In diversen Spelunken zwischen Mississippi und Alabama trank sie feurigen Whiskey mit gebrechlichen Branchen-Veteranen, verbrachte Dutzende Abende auf muffigen Verandas und kehrte irgendwann wieder heim, um all das Erlebte in neue Musik zu verpacken: "Schon bald hatten wir elf Songs zusammen, getränkt in Cowboy-Feeling, eingetunkt in eine kleine Blues-Pfütze und so verdammt aufgetakelt-lässig, wie es nur eine Frau an der Bar sein kann, Stunden nach Mitternacht", beschreibt die Sängerin das Ergebnis.
Und für wahr: "Gravel & Wine" hat definitiv alles, um in einem versifften Saloon für reichlich Stimmung zu sorgen. Zwar bedienen sich Gin Wigmore und Co. nur selten gängiger Western-Elemente, doch irgendwie weckt der Vintage-Sound der Verantwortlichen dennoch durchgehend Erinnerungen an vergangene Zelluloid-Trinkgelage mit John Wayne, Django und Konsorten.
Verrucht und lasziv outet sich die Sängerin auf dem Opener "Black Sheep" als kantige Outsiderin, während im Hintergrund das alte Piano wie wild trippelt, und der Groove einen nicht mehr loslassen will. Wie eine rotzige Amy Winehouse im Hinterhof faucht die Sängerin ins Mikro.
Es folgt das hektische "Man Like That", ein Song voller Hummeln im Allerwertesten. Hier trifft krachende Rhythmik auf nicht minder Impulsives an vorderster Front: Kein Wunder, dass das 007-Management den Song kurzerhand auf den "Skyfall"-Soundtrack parkte.
Mit viel Hall im Gepäck gehts auf der anschließenden Halbballade "Poison" fast schon episch zu, ehe das experimentelle "Kill Of The Night" mit Fingerschnipsen und akzentuierten T.Rex-Gitarren fast schon Mystisches zu Tage fördert. Songs wie "Devil In Me" und "Don't Stop" orientieren sich wiederum an den Einstieg ins Album. Beschwingt und zappelig werden Blues, Rock und Retro-Elemente in einen Topf geworfen. Die Melodien packen einen oftmals erst beim zweiten Durchlauf, dann dafür um so heftiger.
Gin Wigmore kann aber auch anders. Mit "If Only" und "Saturday Smile" präsentiert sich die Bardin von ihrer samtenen Seite: große Piano-Themen und opulentes Schmachten. Zum Ende hin ("Sweet Hell") holt die Belegschaft dann doch noch zum Yippieyayey-Rundumschlag aus. Die Boots werden ausgepackt, das Banjo malträtiert und wer nicht bei Drei das Weite sucht um den hiesigen Sheriff um eine Einzelzelle zu bitten, der sollte sich warm anziehen.
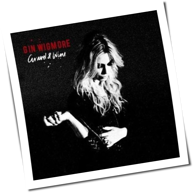



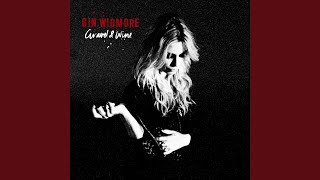






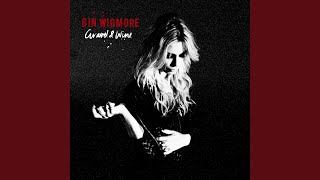

12 Kommentare
Ui, klingt gut!
Also ich mag es nicht so sehr. Es ist für mich ein bisschen zu... hm, keine Ahnung, stressig, gezwungen, nervig. Da ist mir Leslie Clio um einiges lieber, aber ist halt viel ruhiger und entspannter und hat teilweise auch moderne Elemente. Ich verstehe hetzt diesen neuen Trend nicht, wo alle so klingen müssen als kämen sie aus den 60's, 70's, Jake Bugg, Mumford Sons etc. Für mich ist das durchkalkuliert und nicht weniger künstlich als Rihanna, Guetta...
quak quak quak quak
was ist denn das für eine grässliche Ente, die da singt?
Die kriegen ganz sicher eine 2, glaub mir. ;D
@blindluck (« Die kriegen ganz sicher eine 2, glaub mir. ;D »):
Mich würde es trotzdem interessieren. Auch wenn nicht jedes Lied meins ist, der Band kann man eins nicht vorwerfen: mangelnde Abwechslung. Aber da viele Songs überzeugen können und auch schon in letzter Zeit öfter mal als SOundtrack gebraucht wurden, hat es die Band verdient, hier erwähnt zu werden.
Wat ein heißes Ding, ey! Wow!