laut.de-Kritik
Indiefolk aus Berlin mit viel Herzblut.
Review von Giuliano BenassiWie viel Herzblut Julie Mehlum und Phil Haussmann in ihr Bandprojekt stecken, zeigt sich nach der Veröffentlichung des vorliegenden zweiten Albums auf ihrer Bandcamp-Seite. Dort bieten sie eine handsignierte und nummerierte Vinyl-Version an. "Leider sieht es momentan finanziell alles andere als rosig aus, weshalb wir die Platten erst produzieren können, sobald die Produktionskosten wenigstens teilweise drin sind", schreiben sie.
Eine fast schon schmerzliche Ehrlichkeit, die auch ihre Musik und Texte prägt. Klang ihr von Richard Pappik (Element of Crime) produziertes Debüt von 2015 noch folk-poppig, ist die Grundstimmung diesmal etwas rauer, haben sich Mehlum und Haussmann ihrer Punkwurzeln besonnen und mit Janusz Hüsges (Bass) und Jonathan Sieweck (Schlagzeug) zwei weitere Mitglieder an Bord genommen.
Die jugendliche Stimme der Norwegerin klingt deutlich selbstbewusster als auf dem ersten Album und erinnert immer wieder an Cerys Matthews, die walisische Sängerin, die ihre Karriere im neuen Jahrtausend leider aufgegeben zu haben scheint. Haussmann begleitet sie dagegen wie gewohnt in tiefer Stimmlage.
Das funktioniert gut, auch wenn sie in der Regel dieselbe Melodie singen. Es wäre aber mal einen Versuch wert, ein paar Harmonien einzustreuen. Muss ja nicht gleich wie bei den Everly Brothers klingen, wobei das auch ziemlich gut sein kann, wie Bonnie 'Prince' Billy und Dawn McCarthy bewiesen haben.
Mehlum spielt Klavier, Keyboards und Akkordeon, Haussmann meist unverzerrte Gitarre, im Hintergrund sorgen Bass und Schlagzeug immer wieder für anziehendes Tempo. Klingt im Opener etwas scheppernd, passt aber gut zum Text, der eine von Essstörung und Sucht geprägte Beziehung thematisiert.
Sich selbst meinen sie zum Glück nicht. Es ist sicher nicht einfach, ein künstlerisches Leben zu führen, aber wenigstens kann man sich als Paar gegenseitig trösten. "So my love and my best friend / We should run as far as we can / Before life can catch up and swallow everything", singen sie zum Schluss von "Manor Hotel", das auch dank der Akustikgitarrenbegleitung fast zu intim klingt.
Persönliche Problembewältigung ist ein wiederkehrendes Thema. In der Singleauskopplung "(A Tin Can) Odyssey" beschreiben Apples In Space das Gefühl, in der Öffentlichkeit zu stehen, als Bad in einem Haifischbecken. "What a shame, they only know my father's name", beschwert sich darin Phil Haussmann, Sohn des Regisseurs und Schauspielers Leander Haußmann. Recht hat er, aber um eigenständig wahrgenommen zu werden reicht es wohl nicht, den Nachnamen anders zu buchstabieren. Selbst Erfolg kann zu wenig sein. Jakob Dylan oder Adam Cohen können da noch so viele (eigene) Lieder singen.
Selbstproduziert und auf dem eigenen Label Nick & Nora Records veröffentlicht, kann man dem Paar sicherlich nicht vorwerfen, den einfachen Weg zu gehen. Auch wenn es handwerklich noch Verbesserungspotential gibt, stimmt die Einstellung durchaus. Und so schlimm, wie sie die Lage in "Manor Hotel" beschreiben, ist es sicherlich nicht: "We are useless but at least we have the music."
Neben der Musik haben sie hoffentlich bald auch ein paar Vinyl-Ausgaben zum Verschicken: "Sobald wir ein paar LPs vorverkauft haben, geht die Platte in die Produktion."

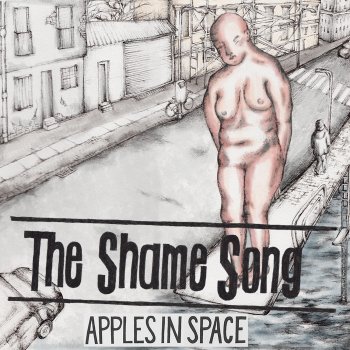












Noch keine Kommentare