laut.de-Kritik
Hinter dem vermeintlichen One Hit Wonder schlummert Gigantisches.
Review von Josef Gasteiger"Shalalalalalala" schallt es einem entgegen. Irgendwie trotzig und flehend zugleich. Über schepperndem Tambourin und ebenso flatternder Gitarre. Aus den Bars, den Trinkanstalten, auf Karaokebühnen, bei Partys, die noch was auf die gute alte Neunziger Musik halten. "Mr. Jones" ist bis heute noch von keinem breiten Formatradio totzukriegen. Wie üblich bei solchen Überhits zückte die Geschmackspolizei natürlich den Stempel "One-Hit-Wonder", im Falle der Counting Crows klebt der nun seit bald 30 Jahren über dem Katalog der Band aus San Francisco.
Schaut man den gefiederten Freunden allerdings etwas unter die Federn, wird klar, was für ein Schatz an Songmannskunst sich hier auf dem Debüt aus dem Jahr 1993 versammelt hat. Nähert man sich diesem Album aufs Neue, passiert das am besten tatsächlich in einem Monat irgendwann nach dem titelspendenden August. Ein bisschen Nebel am Morgen, wahlweise zur viel zu späten Stunde und einem schon geleerten Likörchen. Der Moment, wenn es ganz dunkel ist. Im Brustkorb wie vorm Fenster. In dieser Twilight Zone lebt der poetische Geist von Sänger und Songwriter Adam Duritz voll auf.
Dieser beschenkte uns vor Anfang der Neunziger mit elf wahren Kleinoden von filigranen wie intimen Popsongs, vollgepackt mit zündenden Hooks, brechenden Stimmen, glasklarer Instrumentierung und etwas, das "August And Everything After" bis heute seinen Reiz verleiht: Die fesselnde, dichte, in den Abgrund mitreißende Stimmung. Ein Album wie eine Nacht, in der man noch jung war. Und alles schief geht. Die emotionale Achterbahnfahrt. Die Verzweiflung der Nacht, frühe Übermut, die Liebe, der Crash. Die Ernüchterung, die tiefsinnigen Momente zwischen ein und vier Uhr, die Versöhnung. Verpackt in ein Debütalbum, veröffentlicht aus dem Stand mitten rein in die Hochphase des Grunge.
Im September 1993 lebte Cobain noch, "In Utero" sollte eine Woche nach diesem Debüt den Markt erneut überraschen und die nächste Phase einläuten. Pearl Jam sollten wenige Wochen später ihren famosen Zweitling nachschießen, Alice in Chains drehten Ehrenrunden mit "Dirt", Soundgarden werkelten schon an dem, was uns mit mit "Superunknown" blühen würde. Und etwas weiter östlich ließ auch eine Band mit einem Sänger namens Dave Matthews die ersten Töne erklingen, ebenfalls ein zukünftiger soundtechnischer Referenzpunkt.
Die Explosion eines neuen Genres voll echter Emotion ohne fake Frisuren kam hier wie gerufen. (wobei Front-Ananas Adam Duritz auch Frisur-technisch immer für eine erhobene Augenbraue gut war). Beim Major Label-Gezerre um den Fünfer aus San Francisco hat sich schlussendlich Gary Gersh durchgesetzt, der zuvor auch schon Sonic Youth und Nirvana zu Geffen geholt hat. Für ihn offenbarten die Demos, die in der Bay Area schon Kultcharakter hatten, eine andere Auslegung des gerade heißen Alternative Rocks. Direkt, nahbar, unprätentiös. Aber auch unverzerrt, balladesk. Was auf den bisherigen Erfolgen des Genres nicht die Regel darstellte.
Produzent T Bone Burnett (Elvis Costello, Roy Orbison, Brandi Carlile, Plant & Krauss, "O Brother, Where Art Thou?") verfrachtete die Band auf deren Wunsch in eine große Mansion in den Hügeln von Los Angeles und ließ sie los, mit den Songs, die in den Jahren zuvor zahllose Open Mics und Gigs in und um San Francisco herum begeisterten. Herausgekommen ist perfekt vollendetes Album, ohne einen einzelnen Füller, langatmige Strecken oder Durchhänger.
Die eröffnende Gitarren-Line von David Bryson, dem The Edge zu Duritz' Bono, in "Round Here" pulsiert wie eine entfernte Sirene, die man nur wahrnimmt, nachdem sie längst in der Ferne verblasst, in Gedanken versunken: "Step out the front door like a ghost in the fog / Where no one notices the contrast on white on white". Es geht um den Lebensentwurf, den die jungen Musiker Mitte Zwanzig mit sich selbst verhandeln. Wie lange dem Traum noch folgen? Oder ergibt man sich und folgt dem vorgegebenen Lebensweg, den die Gesellschaft, das Elternhaus, die Institutionen für einen vorgesehen haben? Denn "round here, you always stand up straight". Schon der Opener macht klar, hier ist tiefe Seelenarbeit angesagt.
Duritz' Stimme schmiegt und jammert, flüstert und haucht. Raumausfüllend vorn im Mix, so dass jede Nuance hörbar ist. Viel wichtiger jedoch ist die Aufnahmefähigkeit seiner Lyrics und Melodien direkt eine Etage tiefer, im Herz. Beeindruckend, wie komplett Adam als Vokalist schon in diesen Tagen war. Ob in tiefen sonoren Registern oder – meist in den explodierenden Höhepunkten der Songs – höheren, lauteren Schreien – er realisiert jede Idee und jede Emotion, die er vermitteln möchte. Die gezielt eingesetzten mehrstimmigen Harmonien und Chorgesänge lassen seine Gesangsmelodien noch mehr schweben, als es ohnehin der Fall ist.
Damit er segeln kann, braucht er auch einen Unterbau, der ihm entsprechende Leichtigkeit gibt. Klare, nicht überladene oder gekünstelte Instrumentierung, die ihren Höhepunkt im epischen "Anna Begins" findet mit den wohl der bestklingendsten Drums der Dekade. Akkordeons, Mandolinen, akustische und leicht angezerrte Gitarren zu sparsamen Drums bilden ein solides, meist folkig/rockiges Fundament, auf dem die Poesie des Adam Duritz mühelos jeglichen Spielraum bekommt, den sie braucht.
Damit malt und zeichnet er Bilder und Stimmungen nach Belieben, mit perfekt gezimmerten Songs, die beim Hören einen wahrhaften Film abspulten. In der Hauptrolle natürlich: er selbst. Wir tauchen ein:
Nachdem in "Round Here" die Erwartungshaltungen mal ordentlich zurechtgestutzt wurde, groovt "Omaha" wieder in hoffungsvollere Gefilde. Vielleicht ist das Leben doch außerhalb der Großstadt – "somewhere in middle america" - angenehmer? Oder zumindest nicht alleine? Auf dem Weg dorthin erkennt Adam "get right to the heart that matters, the heart that matters more." Hier sucht jemand händeringend nach mehr.
Der Traum setzt sich fort in "Mr. Jones". Wie wäre es wohl, berühmt zu sein? Fame und fortune klingt hier ganz angenehm. Gehört im Kanon des Albums und nicht zwischen Radiowerbung und Katy Perry, dekodiert man nun endlich auch die Zwischentöne, die einem bislang verborgen blieben. Mit Zeilen wie "believe in me, because I don't believe in anything. And I want to be someone to believe" winkt hier das Impostor-Syndrom mit goldberingten Händen, die nach dem Release auch bald zwei Grammys für dieses Album halten durften.
Aber jeder Traum hört einmal auf. Und aus der fluffigen Gedankenwelt wachen wir hier alle gemeinsam mit dem Sänger auf, um 4:30 Uhr, Dienstagfrüh, in der niederschmetternden Late Night-Introspektive "Perfect Blue Buildings". Und weil die Kluft zwischen Rockstar-Traum und Tellerwäscher-Dasein bei jedem Aufwachen tiefe Risse in die Seele reißt, fleht uns Adam an "please help me stay awake, I am falling". Trotz der tief depressiven Strophen hebt der Refrain den schweren Vorhang zumindest ein bisschen hoch für das erste Licht des Morgens. Wieder einen Tag durchgestanden.
Der Kater am nächsten Morgen richtet den Fokus auf jemand anders, um sich endlich nicht mehr mit den eigenen Unzulänglichkeiten zu beschäftigen. Zum Beispiel auf Anna in "Anna Begins". Wie nach den synkopischen Strophen kurz vor der Zwei Minuten-Marke der Refrain uns den festen Boden unter den Beinen wegzieht, zählt zu den absoluten Gänsehaut-Momenten in einem ohnehin damit dicht gespickten Album. "When kindness falls like rain, it washes me away, and Anna begins to change my mind. Every time she sneezes I believe it's love / I'm not ready for this sort of thing". Immer intensiver schrauben sich die Vocals nach oben, flankiert von mächtigen Harmonie-Chören. Und er sagt es gleichermaßen sich selbst und Anna, dass er auch in Sachen der Herzen genauso wackelig ist wie mit seinem Berufswunsch.
"Time And Time Again" mausert sich von einem ruhigen inneren Monolog auf dem Nachhauseweg eines verkorksten Dates zu einer Deklaration der Wünsche an die Zukunft. Toller Mittelteil ("Sweet Angel") und segelndes Gitarrensolo inklusive. Das Zauberwort Dynamik beherrscht die Band perfekt – und hat durchaus hörbar auch die eine oder andere R.E.M., The Doors und Springsteen-Platte im Schrank stehen. "I can't please myself" schließt hier als Gedanke zusammenfassend die erste Hälfte der Platte ab.
Seite zwei von "August And Everything After" startet mit anstachelndem Uptempo, mit einer bis dato ungehörten Aufgekratztheit. Greift er jetzt an, nimmt er seinen Traum in die eigenen Hände? Lange müssen wir nicht warten, bis uns selbstsicher entgegenschallt "I deserve a little more". Es folgt einer der treibendsten Refrains dieser Zeit als "Rain King", wo die Band schier berstend vor neuer Energie aufspielt.
Man möchte schon meinen, die Crows bleiben bei Sturm und Drang, da schalten sie wieder zurück. Das simple, aber kraftvolle "Sullivan Street" klingt nach dem Moment wenige Minuten nach dem Regen - einem Moment, wo die Luft klar und die Perspektiven auf das eigene Leben noch klarer werden. "I am almost drowning in her sea" erklingt im Duett. Die Herzensangelegenheit ist immer noch nicht ausgestanden, aber irgendwie klingt Duritz robuster, mit dickerem Fell und härterer Schale. Es wäre ihm zu wünschen, auch wenn nicht solches Liedgut in der inneren und künstlerischen Verarbeitung dabei abfallen würde.
Aufarbeitung heißt auch Blick in Richtung der Verflossenen. Dass das gleichermaßen unterhaltsam und schwierig für den Protagonist ist, weiß man nicht erst seit "High Fidelity". Die Crows überlassen dafür aber Bassisten Matt Malley die Mütze des Lockführers im smoothen "Ghost Train". Drummer Steve Bowans präsziser Groove muss sich nie anstrengen, und wenn dann das Orgel-Solo vergangenen Beziehungen von Duritz ein jazziges Ständchen bringt, kommt leise der Verdacht auf, dass wiederum der nächste Höhepunkt in dieser emotionalen Achterbahnfahrt erreicht ist und die Fahrt nach unten nur in Tränen enden kann.
Dort wartet schon die Piano-Ballade "Raining in Baltimore". Mit einem emotional aufgelösten Adam am Mikro, wieder suchend, diesmal die Liebe in der Long Distance. Und wiederum packt er uns mit einer unnachahmbaren Authentizität. "I need a phone call / i need a raincoat / I need a big love / I need a phone call". Hier ist jedes Wort ernst gemeint. Und verdammt, das glaube ich ihm. "I dare you to sing these words and not mean it" hat Eddie Vedder mal auf die Frage geantwortet, ob das tausendste Mal "Alive" singen nicht jeglichen Sinn entledigt. Dieser Gedankenschule gehört Duritz definitiv auch an. Der Stopppunkt ist gesetzt. Wenn es regnet, wird es auch früher dunkel. "I miss you, I guess that I should" – auch diese Beziehung ist nicht erfolgsgekrönt. Die wenigsten sind es. "I'd like to hear a little guitar" bleibt als Gegenpol zum Regenwetter stehen.
Und eine Gitarre phasert sich schön durch die Speaker und leitet das große Finale im Uptempo ein. "A Murder Of One", ein Schwarm mit nur einem Einzelgänger. Adam als ewiger einsamer Wolf? Wohl kaum, hat er doch die Crows um sich, die ihm diesen perfekten Aufschlag beschert haben. Zum Schluss gibt's sowas wie ein Happy End im Counting Crows-Universum mit dem Berg von einem Song. "You don't want to waste your life, darling / change, change, change" lautet das Mantra zum Abschluss. Einsicht als erster Schritt zur Besserung.
Dann ist es vorbei. Knapp 51 Minuten eingesogen in Duritz' lyrische Welt der emotionalen Auf und Abs. Der unerfüllten Träume und gebrochenen Herzen. Perfekt musikalisch eingebettet in packender Produktion. Und das als Debüt. So einnehmend waren Counting Crows danach nicht mehr. Und steigt man ein in "August And Everything After", fällt auch dem optimistischen Geist nur schwer ein, wie die Band das hier jemals hätte toppen können. Ein wahrer Genuss.
In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.

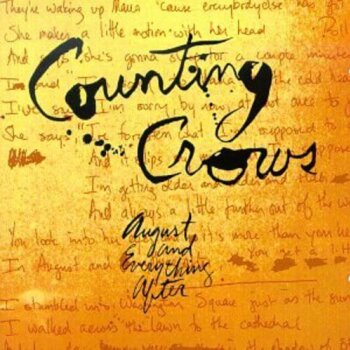





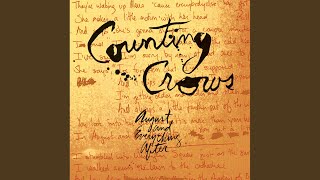





5 Kommentare
Großartiges Album, danke für diese Würdigung! Die Crows in den Jahren danach immer wieder mit Höhepunkten aber leider nie wieder mit der Dichte von August And Everything After - vielleicht bis auf die zuletzt veröffentlichte EP Butter Miracle Suite I, wenngleich auch auf nur 4 Tracks konzentriert.
Ein Hinweis auf die auf dem Cover abgedruckten Lyrics des titelgebenden Tracks, der final erst 2019 aufgenommen und veröffentlich wurde, wäre noch nett gewesen.
Ich bin Ende der Neunziger mit 5 Jahren Verspätung eher zufällig an dieses Album gekommen. Das in allen Radios, in allen Clubs bis zum Erbrechen gespielte „Mr. Jones“ hat mich davon abgehalten, mich mit dem Album näher zu beschäftigen. Diese jaulende Stimme, diese Dylan-Künstler-Attitüde...
Nachdem ich es geschenkt bekommen hatte, fing ich an, es lieben zu lernen. Erst „Omaha“, dann „Rain King“, dann den Rest. Heute höre ich es immer noch gerne, Duritz‘ Poesie wirkt total authentisch, und die musikalische Begleitung passt perfekt dazu. Danke für die Review!
Tolles Album!
Aber jetzt wirds mal wirklich allerhöchste Zeit für ein Meilenstein-Review von Unknown Pleasures von Joy Division!
Ganz viele Erinnerungen an die Musik. Der Mann mit den Socken im Mund. Album lief lange immer im Hintergrund bei Freundinnen...
Noch ein Gedanke: "hopeless cases" von Anne Clark begleitet mich schon seit Ewigkeiten und wird immer besser. Für mich ein Meilenstein! Vielleicht auch für euch?
Schon lange nicht mehr gehört aber das ist in der Tat ein großes Werk, "Round Here" & "Anna Begins" sind Übersongs und "Ghost Train" hat mit der entsprechenden Textzeile Between The Buried And Me ihren Bandnamen gegeben.