laut.de-Kritik
Wer nach diesem Album nicht besoffen ist, der muss es noch mal hören.
Review von Maximilian SchäfferIn den 1960er-Jahren ist der sogenannte "Nashville Sound", eine aalglatte, aufwändig orchestrierte, mit penibelster Studioarbeit geschliffene Version der Countrymusik, das Maß der Dinge. Plattenfirmen konfrontieren die Künstler mit dem Anspruch totaler kreativer Kontrolle über jedes Album. Sänger haben Sänger zu sein, maximal noch Posterboys- und -girls – Komponieren und Texten aber bleibt das Metier der "Profis". Willie Nelson und Waylon Jennings sind 1972 bereits am Ende ihres ersten Karriereabschnitts. Beide sind mittelmäßig erfolgreich, aber resigniert über das enge kreative Korsett, das ihnen seitens RCA Records auferlegt wird. Weil Nelson ein Jahr später zu Atlantic Records wechselt und dort durchaus erfolgreich ist, lässt sich RCA auf einen Deal mit Jennings ein: Für die nächste Platte hat er Narrenfreiheit.
Jennings, dessen Livekonzerte in Texas fast zu gleichen Teilen von Hippies und Rednecks besucht werden, sehnt sich danach, die Atmosphäre der Auftritte aufzufangen. Seine Band The Waylors kommt, wie er selbst, aus dem Rockabilly. Waylon, der für Buddy Holly Bass spielte, bereichert den elegischen Southern Rock um seine ganz eigene Art monotoner Gitarrensoli auf seiner äußerst hohl scheppernden Fender Telecaster. An Visionen bezüglich des Sounds zur Selbstverwirklichung der eigenen Ideen mangelt es also nicht, doch mangelt es an Songmaterial.
Glücklicherweise begegnet er 1972 einem zähen Burschen namens Billy Joe Shaver, ein Songwriter von dermaßenem Kaliber, dass sich später sogar ein gewisser Bob Dylan als Fan outete (vgl. "I Feel A Change Coming"). Der illustre Start der Zusammenarbeit von Jennings und Shaver kann in einer Folge von Mike Judges ("Beavis and Butt-Head") höchst unterhaltsamer Animationsserie "Tales From The Tourbus" nacherlebt werden. Als Jennings sich nur halb interessiert an den "alten Cowboyliedern" zeigt, lässt Shaver nicht locker. Er droht mit Gewalt, Jennings bietet 100$ wenn er sich nach dem ersten schlechten Song verpisst. Doch dazu kommt es nicht, das Material ist so gut, dass Waylon die Vorlagen für sein Anti-Nashville endlich gefunden hat.
"Honky Tonk Heroes" heißt das Album, es erscheint am 25. Juni 1973 auf RCA, vorne drauf sind die guten alten Knaben – Jennings, Shaver und die Band, gemeinsam scherzend. Mit dem Titeltrack geht es auch gleich los, eine Ballade über Suff und Unglück und Armut, die wie die Faust aufs Auge auf den Haudegen Waylon und seinen Bariton passt. Dabei trank er gar nicht so viel Schnaps, gab er 1988 in einem Interview mit dem Spin Magazine zu. Dafür aber schluckte Pillen und rotzte Kokain in einem kaum vorstellbaren Maße. 1.500 Dollar sollen seinen täglichen Bedarf in Höchstform gedeckt haben – Ende der 80er ging er mit einem Schuldenberg von 2,5 Millionen bankrott. Zumindest trifft also die Selbstbezeichnung "loveable loser" zu, die im Refrain gebraucht wird, wenn wohlgleich der "no account boozer" eher als Billy Joe Shaver zu identifizieren ist.
Schon zu Anfang wird klar, wie hervorragend aufgenommen, arrangiert und gesungen dieses Album ist. Die Originalpressung der Platte ist heute sehr teuer, aber auf gutem Equipment abgespielt jeden Cent wert. Waylon croont wie ein Elvis Presley, der ohne sein Valium in einer Eckkneipe gestrandet ist und die Benzos notgedrungen kurzerhand durch den Booze ersetzt hat. So viel Schweiß und Blut der Arbeiterschicht (Blue Collar), so viel Blues des weißen Mannes, so eine exakte Reproduktion einer sinnlos besoffenen Nacht in einer Countrybar voller nostalgischer Illusionen, schaffte vielleicht niemand mehr zuvor und danach. Zum Vergleich kann die deutlich schwächere, alternative Version des Songs "Honky Tonk Heroes (Like Me)" auf der Compilation "The Outlaws" von 1976 herangezogen werden.
Gänsehaut stellt sich auch beim nachfolgenden Song ein, "Old Five And Dimers" nimmt die Geschwindigkeit erst einmal zurück, weil nach einem kurzen Tänzchen schließlich geraucht und vielleicht kurz die Tresennachbarin umarmt werden muss.
Es folgt "Willy The Wandering Gypsy And Me", ein sehnsüchtiger Westernwalzer auf die alten Zeiten und die Tragik rauher Männer, den auch Shane MacGowan so hätte gröhlen können, wäre er nicht auf der Kartoffelinsel geboren. Zwei Violinen untermalen den Refrain, die Lyrik von Shaver präsentiert sich hier auf dem Höhepunkt ihrer Kunst: "Three fingers whiskey pleasures the drinkers / And moving does more than the same thing for me. / Willy he tells me that doers and thinkers / Say movin' is a closest thing to being free. / Willy rosins his riggins laid back his wages / He's dead certain ridin' the big rodeo / My woman's tight with an overdue baby / And Willy keeps yelling hey Gypsy let's go." Man stelle sich vor, auf dem Frühlingsfest der Volksmusik brächte einer solche Zeilen zustande. Der Musikantenstadel aber schaffte in 40 Jahren Sendezeit bisher nur "Über jedes Bacherl geht a Brückerl / Du musst nur a bisserl schaun".
Der flüssige Übergang beim Country von ernstzunehmener Autorenmusik zu plattem Kitsch ist selbstverständlich immer mit einzukalkulieren. Wer aber kann und will so etwas unterscheiden? "Ride Me Down Easy" ist fast schon baptistischer Gospel, christliches Flyover-Hinterland mit LKW-Fahrer-Sehnsucht und Polka-Bums. Wunderschön trotzdem und damit so eindeutig wie bemerkenswert, dass in Deutschland Truck Stop oder Gunter Gabriel entstellte Abbilder solcher Ikonen wie Waylon Jennings formten.
Bemerkenswert ist auch die Kürze der kleinen Anekdoten aus dem modernen und antiquierten Westernleben, kein Song erreicht die Vier-Minuten-Marke, die meisten bleiben sogar deutlich unter drei Minuten. "Black Rose" ist ein 2:28 langer, antirassistischer Country-Dancefloor-Banger: In "The devil made me do it the first time / The second time I've done it on my own!" gesteht der Sänger seine Versuchung und Affäre zu einer schwarzen Frau in Virginia, wo es ganz besondere Hennen gibt. Waylon-typisch gestaltet sich das kleine Solo im Song höchst delikat, auch die begleitende Mundharmonika nervt keineswegs. Ralph Mooney, der langjährige Pedal-Steel-Gitarrist addiert stets feines, zitterartiges Geschwurbel im Hintergrund. Ein wahrhaft breiter Sound für einen Rocksong, der sich dem Eindruck der Überproduktion aber verwehrt, weil jegliche Schnörkel nur dort platziert sind, wo unbedingt notwendig.
Das letzte Stück ist das einzige, bei dem Billy Joe Shaver nicht seine Finger im Spiel hatte, gleichzeitig die zweite Single nach "You Asked Me To" und vielleicht schlechteste Nummer auf dem Album. Sie heißt "We Had It All" und kommt als großgestige Schnulze daher, in der Waylon zum Heldentenor mutiert und wieder deutlich an den King Of Rock'n'Roll erinnert. Die Nummer verweist auf den Konsens des Country in diesen Tagen, also immer noch Nashville, und hat mit dem verrauchten Barrock der restlichen halben Stunde wenig zu tun. Als tränenreicher Abschluss eines langen Abends taugt diese Ballade aber trotzdem, und wer nach diesem Album nicht besoffen ist, der muss es noch mal hören.
In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.






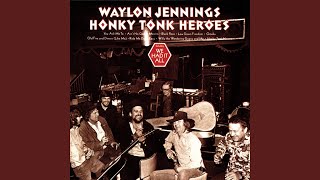







Noch keine Kommentare