laut.de-Kritik
Ohne die phänomenale Lightshow bliebe nur aufgeblasene Langweile.
Review von Ulf KubankeDer Advent ist da. Damit natürlich auch die mittlerweile obligatorische Schiller-Tour-DVD. Wenn der gute Christopher von Deylen weiterhin solch eine vorweihnachtliche Veröffentlichungswut an den Tag legt, gehört er bald ebenso selbstverständlich unter den Baum, wie Spekulatius und Lebkuchen. Nach dem künstlerischen Desaster "Sehnsucht-Live" nun also der "Lichtblick". Treffender hätte man den Titel nicht auswählen können. Noch immer fehlt in kompositorischer Hinsicht die qualitative Homogenität. Gleichzeitig hat sich einiges im Hause Schiller zum Besseren entwickelt.
Quantitativ schnürte man das Fanpaket perfekt. Das Kernstück bildet der komplette "Atemlos"-Live-Gig aus Hamburg. Daneben gibt es ein Berliner Geheimkonzert in rein instrumentaler, leicht abgespeckter Fassung im kleinen Kreise. Als Sahnehäubchen winkt eine Audio-CD mit neun komplett neuen Tracks. So weit, so opulent.
'Global-Pop' nennt er es jetzt hochtrabend. Geht es noch nichtssagender? Im Gegensatz wozu, bitte? Ghetto-Pop? Tatsächlich erweist sich das Hamburg-Konzert in Teilen als Weiterentwicklung des bekannten Schiller-Konzepts.
Die Lightshow ist schlichtweg phänomenal und in ihrer visuellen Sinnlichkeit sogar am Bildschirm erfühlbar. Erfreulicherweise orientiert sich der Mann aus Visselhövede nicht an den großen Lichtern von etwa Pink Floyds Pulse oder U2. Nein, das Meer aus Scheinwerfern erstrahlt als ganz eigene, abwechslungsreiche und beeindruckende Kreation, die jede noch so finstere Polaranacht zum Funkeln bringt. Augenbonbons für alle!
Auch bei den Gastvokalistinnen darf man die Auswahl des Norddeutschen überwiegend als gelungen bezeichnen. Die Osloer Eisfee Kate Havnevik (u.a. Röyksopp) glänzt vor allem bei "The Fire" mit ihrer kristallenen Fjordstimme sowie leichten Björk-Reminiszenzen ("Homogenic").
Momente absolute Brillanz zeigen sich gleichwohl erst in der Performance von Anggun. Die frankophone Indonesierin erobert "Blind" und "Innocent Lies" mit einer beiläufigen Lässigkeit, die man nur bei den weltbesten Chanteusen bewundern kann. Keine Drama Queen, kein Overacting. Stattdessen die totale Verschmelzung von Stimme, Gestik und Mimik mit Band und Song. Nur wer in dieser Weise ein Lied fühlt, transportiert Gefühle bis ins Wohnzimmer. Unbedingter Anspieltipp: "Always You".
Fast tragisch zweitklassig mutet dagegen die schon bei "Sehnsucht – Live" überforderte Kim Sanders an. Zwar technisch sauber, aber seelenlos und jeder songdienlichen Ausstrahlung beraubt, ruft die ehemalige Captain Hollywood-Dance-Diva ihre drei Stücke in die Menge. Unfreiwillig komisch wirkt der Kontrast zu Anggun, vor allem in der karikaturhaften Ergriffenheit von sich selbst und der eigenen Darbietung. Gut, dass es die Skiptaste gibt.
Bei der bunten Mischung aus "Atemlos"-Instrumentals und weiteren gesangslosen Schiller-Evergreens taucht dann geschwind die altbekannte Schwäche im Songwriting auf. Sicher, die Effekte sind nett und pseudo-psychedelisch. Die Band besteht aus großartigen Musikern, allen voran der herausragende Donnergott Cliff Hewitt an den E-Drums. Doch das wiederholt stetige Kopieren von Vorbildern à la Faithless bis hin zum Knopfler-Dire Straits-Solo (dieses Mal trifft es nicht Gilmour!) unterstreicht leider erneut die kompositorische Schwäche vieler Tracks.
Wohlgemerkt: Zitieren ist okay. Aber nur, sofern man auch über genug eigenständige Ideen verfügt. Während der Hörer stets hofft: 'Jetzt legt er auch mal am Synthie-Piano richtig entfesselt los!', erstirbt jeder melodische Ansatz bereits im Keim. Das quälende dauernde Variieren derselben bzw. höchst ähnlichen drei bis fünf Noten als Effekt haschendes Dam-di-dam-Grundthema verliert seinen Reiz - wie immer - sehr schnell.
Wem dabei versehentlich die Augen zufallen, dem bleibt ohne die farbenfrohen Spotlights leider über weite Strecken nur gepflegt aufgeblasene Langweile im recht herkömmlichen Dream-Trance-Kostüm. Da hilft auch Onkel Midge nicht mehr. Der Ultravox-Haudegen und "Dancing With Tears In My Eyes"-Schöpfer müht sich redlich durch das laue Vakuumliedchen "Let It Rise". Da schießen einem auch beim Zusehen dicke Tränen in die Augen - allerdings nicht vor Rührung.
Dieselben Stärken und Schwächen spiegelt die Audio-Platte eins zu eins wieder. Man möchte den sympathischen Norddeutschen förmlich schütteln und anflehen: Weniger bedeutungsschwangere Elektro-Buttercreme-Inszenierung für gänzlich Unbedarfte, mehr Konzentration auf das Entwickeln vollständiger Melodien! Die richtigen Vorbilder hat er doch allesamt erkannt. Und Altmeister Eno hat auch gerade gezeigt, wo die Ambient-Messlatte hängt. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Nächstes Jahr ist schließlich auch wieder Weihnachten.

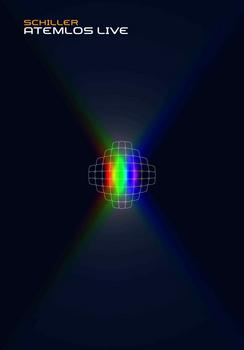












Noch keine Kommentare